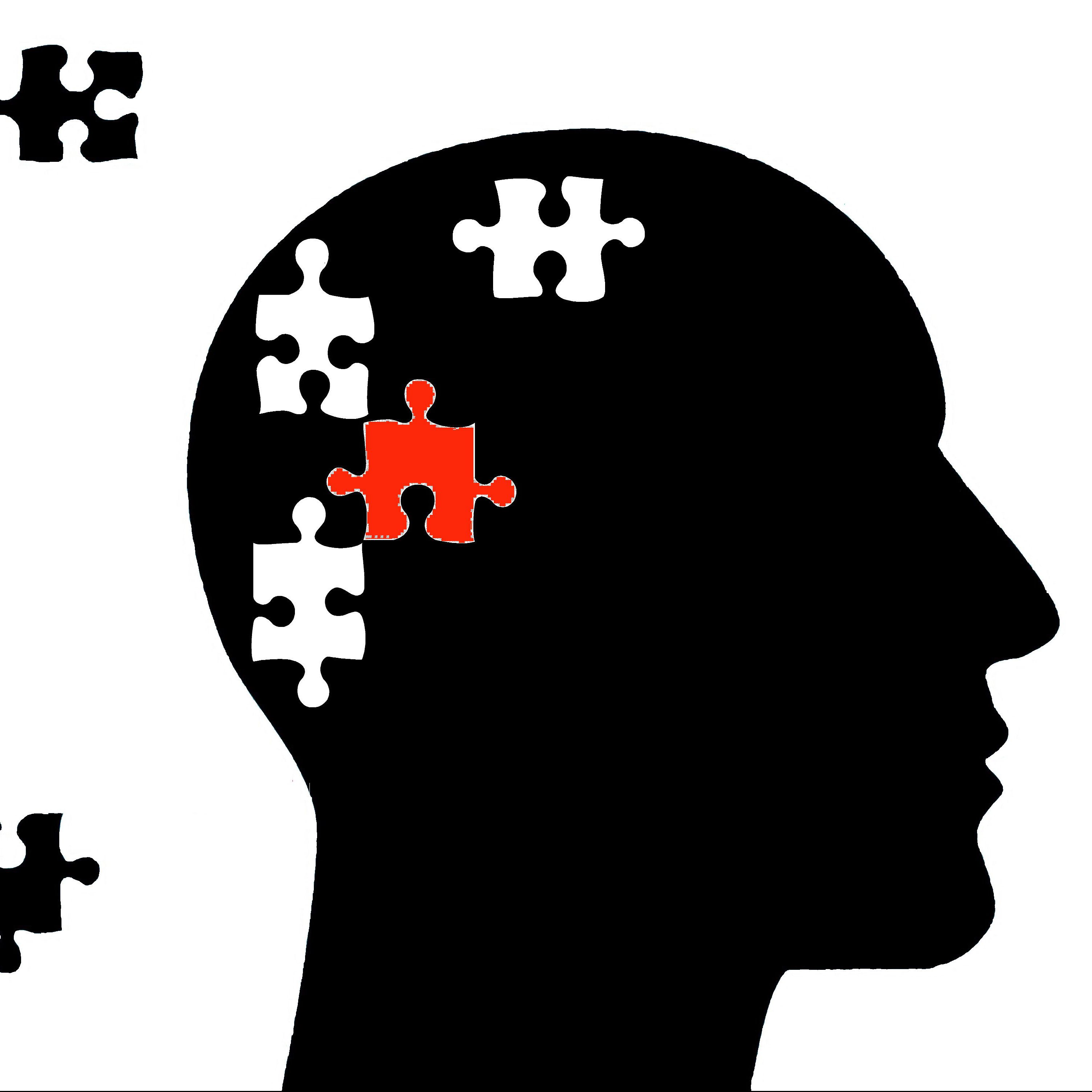Fachtag „Trauma und Gewalt“
am 15.06.2018 in Berlin Lichtenberg
(Patric Tavanti)
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr
geehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Frau Stadträtin
Framke,
ich freue mich sehr, heute hier vor diesem großen Auditorium zu stehen.
Als wir vor fast genau einem Jahr die Idee für diesen Fachtag in der
großen Regio 3 hatten, gingen wir von vielleicht 30 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aus. Vier Mal mussten wir im Verlauf der Vorbereitungen
aufgrund des großen Interesses den Veranstaltungsort wechseln. Und
ich freue mich, dass die blu:boks uns so herzlich aufgenommen und uns
ihre Räume zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank!
Ich möchte mich auch bei der Landeskommission Berlin gegen Gewalt
für die finanzielle Ausstattung des Fachtags bedanken. Und bei den
Referentinnen und Referenten, die uns ihre Zeit, ihre Erfahrung und ihr
Wissen zur Verfügung stellen. Alle leisten in ihrer Arbeit als
Therapeutinnen, Traumafachberaterinnen und Sozialarbeiterinnen einen wichtigen Beitrag in der Betreuung und Begleitung von traumatisierten Menschen, einige von ihnen sind international gefragte Fachleute. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind! Ein herzliches Dankeschön auch an die vielen Helferinnen und Helfer, die uns bei der Organisation, Durchführung und Dokumentation dieses Fachtags unterstützen. Und ebenso an das „Medienkompetenzzentrum Die Lücke“ und den Caritasverband Berlin, die als Träger diesen Fachtag ausrichten. Nicht zuletzt geht mein ganz besonderer Dank an Frau Brigitte Gondek. Brigitte, ohne Deine Intuition, Initiative und Dein unermüdliches Engagement wäre dieser Fachtag nie zustande gekommen. Ich habe die Ehre und Freude, den Eröffnungsvortrag übernehmen zu dürfen. Ich will ganz unwissenschaftlich beginnen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Wir werden heute sehr viel über Psychotraumata sprechen, über den Umgang mit den Betroffenen, über die Opfer und die Täterinnen und Täter, über ihre Angehörigen und die Schwierigkeiten und Herausforderungen für Betroffene und Helferinnen und Helfer, die ein Leben mit einem Psychotrauma bedeuten. Wir werden viel über Leid, Angst, Wut und Verzweiflung hören, über individuelle Schicksale. Für viele von uns gehört es zur täglichen Arbeit, mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, Geflüchteten, Seniorinnen und Senioren umzugehen. Unser Auftrag ist, ihnen zu helfen. So ergibt sich oft in unserer Wahrnehmung der Welt ein tiefer Graben zwischen denen und uns, zwischen Hilfesuchenden und Helfenden. Das kann, und wenn auch nur unbewusst, schnell zu einem noch tieferen Graben und zu einer noch verzerrteren Wahrnehmung führen: zu Opfern und Retterinnen und Rettern. Doch es geht heute und hier nicht nur um Opfer und Helferinnen und Helfer, es geht nicht nur um persönliche und individuelle Schwierigkeiten und Störungen. Ja, in der ICD-10, der „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“ der WHO ist eine traumatische und posttraumatische Reaktion als Störung klassifiziert, als etwas, das eine „deutliche Abweichung von der gesellschaftlichen oder medizinischen Normvorstellung psychischer Funktionen“ bedeutet. (http:// www.doccheck.com) Und der Graben wird in unserer Wahrnehmung noch tiefer: Dort die Kranken, die Abweichler, die Gestörten, hier wir, die Normalen, die Richtigen, die Guten, die Gesunden. Von Jiddu Krishnamurti ist das Zitat überliefert: „Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.“ Eine Gesellschaft, in der über 30 % aller Kinder psychische und/oder physische Gewalt in der Familie erleben, in der 58% der in einer Prävalenzstudie (Schröttle 2004) befragten Frauen angaben, schon einmal sexualisierte Belästigung und über 13% sexualisierte Gewalt erfahren zu haben – und in der allgemein davon ausgegangen wird, dass jedes 4. bis 5. Mädchen und jeder 12.-14. Junge in Kindheit oder Jugend sexuelle Übergriffe erlebt hat, in der Aggression, Mobbing und Ausgrenzung zum täglichen Leben gehören, in der Eltern noch heute sagen „ich wurde von meinen Eltern auch geschlagen und es hat mir nicht geschadet“, eine solche Gesellschaft ist zu tiefst krank. Wir wissen heute, dass Psychotraumata von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, nicht nur durch die Weitervermittlung von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern, sondern auch genetisch. In uns allen sind durch den ersten und zweiten Weltkrieg, durch Gewalterfahrungen, durch Unfälle und Katastrophen traumatisch veränderte Gene aktiv und beeinflussen unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Wahrnehmung der Welt, unsere Einstellung zum Leben selbst. Und wir wissen es nicht, wir denken, so, wie wir die Welt erleben sei normal. Wir lesen blutrünstige Krimis, sehen gruselige Horrorfilme, zucken bei den Nachrichten über Krieg, Verfolgung, Hunger nur mehr mit den Schultern. Und verstehen nicht, dass unsere Normalität gerade nicht normal ist, sondern ein Symptom für eine „deutliche Abweichung unserer psychischen Funktionen“, um noch einmal die Definition der ICD 10 aufzugreifen. Jean Liedloff beschreibt in ihrem Buch „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück: Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit“ eine ganz andere Normalität, eine ganz andere Gesellschaft. Sie berichtet von einem Indianerstamm, den Yequana, der in den Tiefen des Urwaldes des Amazonas lebt. Ein Stamm, der ein Leben ohne Angst und Entfremdung, ohne Wettstreit und Aggression, ein Leben ungebrochener Daseinslust, des Friedens mit sich und den anderen lebt. Die Gemeinschaft ist hochentwickelt, gegründet auf Vertrauen und unbedingten Respekt vor dem Willen und der Würde des anderen. Alle helfen einander ohne Gegenleistungen zu erwarten. Jeder arbeitet, so lange er Lust hat, wenn ein anderer noch weiter Lust hat, arbeitet er eben länger als der andere, einfach, weil er Freude daran hat. Wobei die Yequana nicht mal ein Wort für Arbeit haben, wie wir es kennen und verstehen, zwischen Tanzen, Singen und Feldarbeit gibt es keinen sprachlichen Unterschied. Warum auch? Es gibt unter ihnen keinen Druck, keinen Zwang, keine Manipulation – und keine Notwendigkeit zum Streit; keine abfälligen Urteile über persönliche Eigenheiten, Toleranz auch für ungewöhnliches Verhalten. Auch Kindern gegenüber gilt dieser Respekt. Eine aktive Erziehung in unserem Sinne erhalten sie kaum; sie lernen selbsttätig durch Beobachtung und Imitation. Die Kinder sind immer mit dabei, bei der Arbeit, beim Kochen, beim Feiern. Die kleinsten sind in einem Tuch seitlich an der Hüfte der Mutter immer in Körperkontakt. Liedloff beschreibt, dass die Kinder der Yequana in ihrer Entwicklung nichts als unerledigt, unbefriedigt abspalten müssen, um überleben zu können. Sie müssen nicht ihre Lebensenergie blockieren mit der Abwehr gegen unbewusste Angst und verdrängte Wut, die sie dann als Erwachsene ausagieren müssten. Sie sind nicht durch eine westlich-zivilisierte Erziehung auf das Unglücklichsein in einer grundsätzlich feindseligen Welt programmiert worden wie der moderne Zivilisationsmensch mit seinen neurotischen Spannungen, psychosomatischen Krankheiten und latenten Selbstmordtendenzen, wie Hans Krieger es in einem Artikel über Liedloff in der Zeit auf den Punkt bringt. Wilhelm Reich postulierte, dass der Mensch eine durch Selbstregulierung wirkende natürliche Sozialität besitze, die nur tief verschüttet sei durch die Tradition der Unterdrückung; erst diese Unterdrückung lasse die Triebe zur Bösartigkeit pervertieren. Hans Krieger fragt in seinem besagten Artikel von 1981: „Sollte im Schöpfungsplan doch vorgesehen sein, dass der Mensch glücklich sei?“ In der Apostelgeschichte heißt es: Sie waren „ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. (…) Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, (…) Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.“ (AG 4,32-35, EÜ 2016) Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser: „Einst war auch euer Lebenswandel von solchen Dingen bestimmt, ihr habt darin gelebt. Jetzt aber sollt auch ihr das alles ablegen: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Munde kommt. Belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen (…) da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie (…) Bekleidet euch also (…) mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld! Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! (…) Seid dankbar! (Kolosser 3, 8-15) Warum erscheinen uns solchen Aussagen über die Möglichkeit des menschlichen Zusammenlebens als süßlich-kitschige Utopie, über die wir milde den Kopf schütteln oder sogar mit Wut und Ablehnung reagieren? Warum fühlen wir uns in einer Gesellschaft, in der Hierarchie, Gewalt, Ausgrenzung, Ausbeutung, Verachtung, Vergeltung und Krieg unser Leben bestimmen, wohler? Haben wir es uns im Trauma eingerichtet, fühlen wir uns in einem „normalen Zustand von Traumatisierung“ so zuhause, dass nur noch die, die sich darin nicht zu Hause fühlen als krank gelten, obwohl doch ihre Reaktion eher als gesund anzuerkennen ist? Nelson Mandela sagte einmal: „Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann Ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.“ Vergessen wir heute nicht, dass hier nicht Expertinnen und Experten mit Helferinnen und Rettern sprechen, sondern Kranke zu Kranken, die sich
in erster Linie erst einmal selbst helfen müssen, bevor sie auch anderen
helfen können.
Und bei allem Trauma, vergessen wir nicht auch zu träumen. Ich
wünsche uns allen einen erkenntnisreichen und guten Tag.